Umweltschutz und wirtschaftliches Handeln vereinen.
Michael Stoll
Geschäftsführer der REMEX GmbH, Vorsitzender der Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e.V. und Präsident der Fédération Internationale du Recyclage (FIR).

Erfahren Sie mehr über die Person und die Aktivitäten von Michael Stoll
Fortschritt für Generationen
Mineralische Rohstoffe gehören zum Wertvollsten, was die Natur uns bietet. Viel zu lange wurden Landschaften im Zuge der Baustoffgewinnung zerstört, wurde die Verfügbarkeit von Naturbaustoffen wie Kies und Sand als selbstverständlich angesehen. Mineralstoffe werden größtenteils im Zuge von Infrastruktur- und Bauprojekten benötigt und nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer entsorgt. Ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Ressourcen ist zwingend, wenn wir die Umwelt schützen und gleichzeitig den Bedarf zukünftiger Generationen sichern wollen.
Das Thema ist von nationaler und internationaler Bedeutung. Weltweit stehen wir vor der großen Herausforderung, den Bedarf der Menschen an Baustoffen zu decken. Jährlich werden allein mehr als 50 Mrd. Tonnen Sand benötigt, mit steigender Tendenz aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der Urbanisierung in vielen Ländern der Erde. Es bedarf konkreter und innovativer Lösungen, die die effiziente Nutzung mineralischer Abfälle als potenzielle Materialquellen einschließen.
Mit all meinen Möglichkeiten setze ich mich in diesem Zusammenhang für höhere Recyclingquoten und nachhaltige Kreislaufführung ein. Darüber hinaus unterstütze ich aktiv die Ziele einer Zero Waste Economy und plädiere für die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie in der Baustoffindustrie.
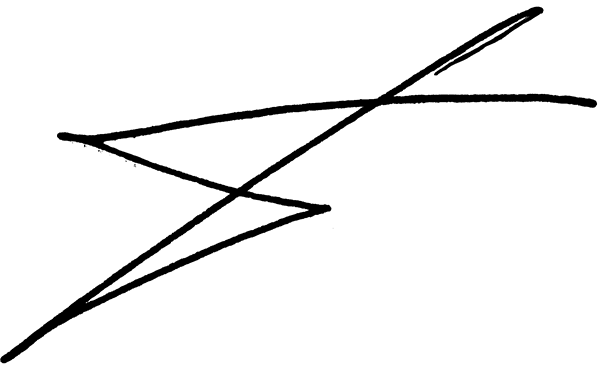
Michael Stoll
Kompetenzen und Vita
Kompetenzen
Seine umfangreichen Erfahrungen im nachhaltigen Management mineralischer Abfälle machen Michael Stoll zu einem gefragten Experten in den Feldern Kreislaufwirtschaft und Mineralstoffrecycling. Mit dem Anspruch, den Wissensaustausch zu forcieren, Kooperationspotenziale zu erkennen sowie eine vertrauensvolle Business-Kultur zu etablieren, ist er ein versierter Förderer von internationalen Netzwerken bis hin zu chancenreichen Mergers and Acquisitions. Die zutreffende Bewertung makro- und mikroökonomischer Faktoren zählt ebenso zu seinen Stärken wie zukunftsorientiertes Handeln im Hinblick auf strategisches Wachstum bei ausgewiesener Stabilität. Seine Konzepte zur Absicherung unternehmerischer Risiken und sein Wissen um die Bedeutung von Digitalisierung sind dabei entscheidende Erfolgsfaktoren.
Vita
Michael Stoll, Jahrgang 1962, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Essen. Bereits in den ersten Berufsjahren verfolgte er ein klares Ziel: die Steigerung der Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft. Nach beruflichen Stationen bei der DEUTAG-REMEX Gesellschaft für Baustoffaufbereitung mbH und der B+R Baustoff-Handel und -Recycling GmbH wurde er 2001 zum Geschäftsführer der REMEX GmbH berufen. Bis heute verantwortet er die Geschicke des Unternehmens, das sich unter seiner Führung national und international als Spezialist für die Rückgewinnung von Ressourcen aus mineralischen Abfällen etabliert hat.